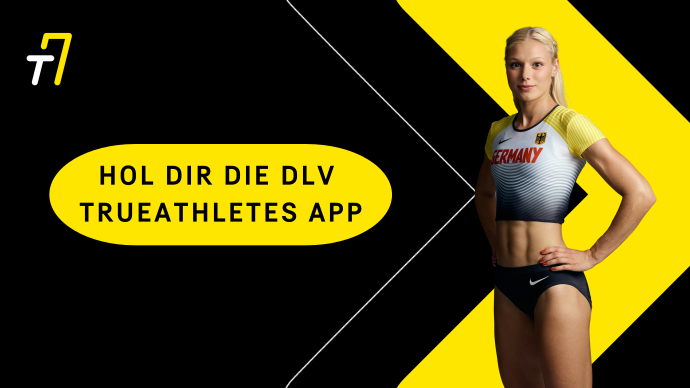Verlieren ist keine Option. Nach dieser Devise hat der ehemalige Stabhochspringer Tim Lobinger schon immer gelebt – zu seiner aktiven Zeit als Sechs-Meter-Springer und auch heute, denn der 45-Jährige ist erneut an Blutkrebs erkrankt. Im Interview mit leichtathletik.de spricht er über seinen Umgang mit der Krankheit, warum ihm sein Leistungssportdenken auch heute noch weiterhilft und welchen Rat er aktiven Stabhochspringern geben möchte. Verarbeitet hat er seine Krankheit in dem beeindruckenden Buch "Verlieren ist keine Option - Mein Kampf gegen den Krebs", das im Riva Verlag produziert wurde. Eine ausführliche Rezension erscheint am Freitag auf leichtathletik.de.
Tim Lobinger, wie geht es Ihnen?
Tim Lobinger:
Mir geht es gut. Wer mich jetzt einen Tag lang begleitet, würde nicht vermuten, dass ich ein Jahr wie das letzte hinter mir habe und noch als krank gelte. Inzwischen kann ich auch wieder Ausdauer trainieren. Damit ist meine Lebensqualität wie früher. Das ist für mich natürlich eine schöne Situation.
Auf Bayern3 haben Sie kürzlich erzählt, Sie wären eine “Krebsbestzeit” von 4,16 Sekunden über 30 Meter gelaufen, eine Distanz, die im Hockeysport und im Fußball häufig trainiert wird.
Tim Lobinger:
Das ist natürlich lächerlich im Vergleich zu früher, für mich aber toll, weil ich im letzten Jahr zur selben Zeit weder sprinten, geschweige denn joggen konnte. Es hat bis Weihnachten gedauert, bis ich letzteres wieder ansatzweise geschafft habe.
Ist es wirklich gut, dass Sie jetzt schon wieder Ihre Grenzen austesten?
Tim Lobinger:
Eine klare und einheitliche Botschaft der Ärzte ist, dass jede Form von Bewegung unheimlich wichtig für mich ist, körperlich wie mental. Das gilt vor allem für das Verarbeiten der Extremsituation. Für mich ist die sicher anders als für Sie. Wenn ich sprinte, ist das für mich nicht belastender als für andere das langsame Laufen. Insofern hat jeder seine eigenen Grenzen. Ich kämpfe mir jeden Tag ein Stück Normalität zurück, und dazu gehört eben auch das Sprinten.
Aber Ausdauer heißt, Sie laufen jetzt auch längere Strecken?
Tim Lobinger:
Nein, das nicht. Bis 2012 bin ich als aktiver Leistungssportler maximal 12 Kilometer am Stück gelaufen. Einen Regenerationslauf von vier bis fünf Kilometern habe ich in sechseinhalb bis sieben Minuten pro Kilometer absolviert. Das ist schon sehr gemütlich. Das Brutalste, was ich mir mal gegönnt habe, war der Wings for Life World Run in Länge eines halben Marathons. Nach der Krankheit habe ich dann erst im April wieder mit Ausdauertraining begonnen. Davor war ich nicht länger als fünf Minuten auf dem Ergometer, und das auch nur unter 100 Watt. Das Ausdauerthema habe ich bewusst gemieden, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht guttut. Mein Herz, mein System wollten das nicht. Sanftes Krafttraining habe ich dagegen die ganze Zeit, auch während der Chemotherapie, sehr gut vertragen. Das wiederum hat mir das Gefühl von Selbstbewusstsein zurückgegeben.
Wie sehen die Ärzte Sport während der Chemo?
Tim Lobinger:
Es wird jedem Erkrankten empfohlen, mit Sport zu beginnen in der Zeit, in der es eh nur um Klinikaufenthalte und Genesung geht. Es gibt Studien über Menschen mit Leukämie und schweren Krebserkrankungen, die es geschafft haben, Sport zu machen, und die so eine wesentlich höhere Lebenserwartung haben. Diese Tatsache wird durch die Ärzte ab Tag eins kommuniziert.
Eigentlich müssten Sie aber nicht auf irgendwelche Zeiten schauen…
Tim Lobinger:
Das ist für mich aber Normalität und die brauche ich. Seit ich 14 bin, führe ich Trainingstagebücher und dokumentiere mein Leben in Zahlen. Jetzt zu merken, dass ich gar nicht so weit weg bin von dem, was ich mir für mein Alter erwünscht habe, ist schön. Davon lass ich mich jetzt auch nicht durch den Krebs abhalten. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, aber ich habe meine Ideale und versuche etwas aus meiner früheren Zeit zu ziehen, um so auf meiner Linie zu bleiben. Ich bin und bleibe Leistungssportler.
Als solcher hilft es sicher, dass Sie Schmerzen und das Kämpfen gut kennen…
Tim Lobinger:
Ich habe Schmerz immer als Herausforderung und Trainingsprozess gesehen, genauso wie die Chemotherapie. Die ist ja auch eine Grenzerfahrung. Ich habe mir gesagt: So Lobinger, jetzt hast du eine neue Herausforderung, die es so noch nicht in deinem Leben gab. Jetzt kannst du es beweisen! Es ist wie die Bestleitung im Krafttraining oder das Angehen einer Höhe, die man noch nicht überwunden hat. Am Ende des Tages geht es darum, sich zusammenzureißen und eine Strategie zu entwerfen, um das hinter sich zu bringen und zu gewinnen. Oder um zu überleben. Dieses Vorgehen hat mir während der Chemotherapie wirklich geholfen. Ich habe mir gesagt, der Startschuss ist gefallen, jetzt liegen 96 Stunden vor mir und ich werde meinen Körper schon irgendwie unter Kontrolle bekommen.
Das klingt dennoch sehr streng.
Tim Lobinger:
Das ist auch meine Art. Verlieren ist keine Option, Aufgeben gibt es nicht. Eine Enttäuschung hake ich ab und sage mir, okay, bis hierhin hat es nicht geklappt, aber ab jetzt funktioniert es. Ich will kämpfen, das hatte eine unheimliche Eigendynamik. Natürlich sind auch Tiefschläge da gewesen. Als ich im Januar von der Neudiagnose und der Perspektive, nochmal transplantiert zu werden, hörte, war ich erstmal zerschmettert. Aber dann sagte ich mir, ich habe noch eine Chance zu überleben und es neu anzugehen. Ich will ein Leben führen, also stecke ich die Ziele neu.
Sie sagten, in Ihrem Leben vor dem Krebs gab es bezogen auf Krankheiten nur Wehwehchen und Schnupfen, auch wenn es durchaus ernstere Sachen waren. Wäre es aus heutiger Sicht nicht vernünftiger, ein bisschen milder mit sich zu sein?
Tim Lobinger:
Dieses Ding, raus aus der Komfortzone zu kommen, an Grenzen zu gehen und hart zu sich zu sein, das gehört für mich dazu, weil es die Willensstärke und Charaktereigenschaften formt. Den Gesundheitscheck und das Monitoring halte ich aber für wichtig. Man sollte sich zwingen, wenigstens einmal im Jahr ein großes Blutbild zu machen und einmal im Jahr eine Herzuntersuchung. Da schlampig zu sein, ist der falsche Weg.
Wie stehen Sie dazu, dass viele Sportler ständig Schmerzmittel nehmen, wie z.B. Robert Harting, der sich für die EM fitmachen will? Würden Sie aus heutiger Sicht sagen, es sollte auch andere Wege geben?
Tim Lobinger:
Schmerzmittel sind nicht gleich Schmerzmittel. Ibuprofen gehörte zum Beispiel zu meiner Sportkarriere auch dazu und war das Allheilmittel für vieles. Ich hatte über Jahre chronische Achillessehnenprobleme und bedingt durch die lange Karriere Schulterprobleme. Ich konnte mit Schmerzen gut dealen, aber es gab im Wettkampf eben auch Momente, wo man sie dämpfen wollte. Ich will Schmerzmittel nicht verharmlosen, aber ich glaube, jeder mit Rückenschmerzen weiß, wovon ich spreche. Fakt ist: im Schnitt nimmt jeder Durchschnittsbürger mehr als fünf Schmerztabletten pro Monat zu sich. Die Mehrzahl an Sportlern nimmt auch nicht mehr, außer vielleicht in harten Wettkampfphasen oder bei Verletzungen. Gefährlicher ist es mit Schlafmitteln, um die Erholung zu beeinflussen. Ich habe es ohne geschafft, mit Atemtechnik erreicht man ja auch viel.
Wie stehen Sie jetzt im Vergleich zu früher zu Ärzten?
Tim Lobinger:
Mein Verhältnis zu Ärzten war schon immer gut. Ich hatte ja ein gutes Umfeld, das mir kurzfristig immer geholfen hat. Mit 14, 15 ist es zum Beispiel normal, Knochenhautprobleme zu bekommen, wenn man viel trainiert. Schon da habe ich mir helfen lassen, den ich wusste, wenn ich es sportlich nicht lösen kann, dann frage ich einen Arzt. In Köln und Leverkusen ging das immer gut beim Training. Zum Ende meiner Karriere hin waren es dann die Vorsorgeuntersuchungen, die mich zu Ärzten trieben. Ich hatte für jede Verletzung aber immer einen speziellen Arzt und bin nie herumgesprungen, um den einen Arzt zu finden, der mir nach dem Mund redet. So war es jetzt auch im letzten Jahr mit dem Krankenhaus. Ich habe mich für das eine in München entschieden und auf all das gehört, was mir da empfohlen wurde. Das hat mir sicher auch viel Stress erspart.
Dass Sie sich bis heute an Ihren Sprung über sechs Meter im Jahr 1997 erinnern und ihn als positive Erinnerung jederzeit abrufen können, hilft sicher in Stresssituationen weiter…
Tim Lobinger:
Definitiv. Ich habe ja ganz früh angefangen, nicht nur sportwissenschaftliche Bücher zu lesen, sondern mich auch psychologisch fortzubilden. Meine Schwester Babett ist nach wie vor als Sportpsychologin sehr erfolgreich und hat mir in vielen Gesprächen gezeigt, dass es wichtig ist, Dinge zu reflektieren und zu hinterfragen, gerade wenn es gut läuft. Wenn‘s mal nicht läuft, solltest du einen Mechanismus bereit haben, von dem du weißt, dass er half, als alles lief. Diese Überzeugung teile ich und deshalb sage ich auch lieber, dass ich Coach bin und nicht nur ein Athletiktrainer.
Sollte psychologische Hilfe Leistungssportlern präventiv angeboten werden?
Tim Lobinger:
Mentaltraining ist wie Bankdrücken und Sprinten: Manche Sportler können das von Natur aus, 90 Prozent aber nicht. Ein Psychologe kann insofern wichtig sein. Es darf aber kein Abhängigkeitsverhältnis entstehen. Viele Sportler brauchen beim Wettkampf den Blick ins Publikum und werden unruhig, wenn der eigene Psychologe nicht mit im Stadion ist. Das würde ich eher verurteilen. Selbständigkeit und Unabhängigkeit ist das wichtigste im Stadion und auch später im Leben.
Als Leichtathletiktrainer vertreten Sie die Meinung, dass Sport auch Spaß sein muss.
Tim Lobinger:
Das ist doch die Basis für alles im Leben! Wenn du an deinem Beruf keinen Spaß mehr hast, dann solltest du den Mut finden, etwas zu verändern. Ich habe vor allen Menschen Respekt, die sich trauen, ins kalte Wasser zu springen. Da ziehe ich den Hut.
Auf Bayern3 haben Sie gesagt, Sie wollen sich beruflich mehr austoben. Gibt es da schon einen konkreten Plan?
Tim Lobinger:
Die Athletenbetreuung ist auf alle Fälle weiter dabei. Dazu gehören Fußballer wie Joshua Kimmich, Feldhockeyspieler, Schwimmer, ein Rallyefahrer und andere. Ich habe aktuell 40 bis 50 Sportler, die ich betreue, aber das geht eben auch mal telefonisch. Dass der Pool so groß ist, gefällt mir und soll auch so bleiben. Es geht für mich in Zukunft aber auch noch mal um Selbständigkeit oder um einen Verein. Das wird wohl zweigleisig werden mit einer eigenen Institution und was Öffentlichem. Für Letzteres stehe ich ja auch.
Öffentlichkeit war schon immer Ihr Ding, das stimmt. Bereuen Sie da irgendetwas?
Tim Lobinger:
Vielleicht würde ich es heute anders angehen und gezielter etwas preisgeben. Wenn ich mir anderseits anschaue, was man als Influencer verdienen kann, dann wäre das wohl genau mein Ding gewesen zu meiner Zeit. Da hätte ich richtig viel rausholen können. Ich schmunzle übrigens immer noch über das Bildmaterial von mir früher. Irgendwie war ich schon schräg drauf. Dass jemand sagt, er kann mich nicht leiden, musste ich mir aber auch erst einmal erarbeiten. (lacht)
In der Leichtathletik ist Aufmerksamkeit wichtig, vor allem wenn es um Sponsoren und damit um Geld geht. Im Vergleich zum Fußball gibt es da allerdings ein großes Ungleichgewicht. Wie sehen Sie das?
Tim Lobinger:
Ich mach dieses Ungleichgewicht dem Fußball nicht zum Vorwurf, da das Geld, was da verdient wird, allein deshalb gerechtfertigt ist, weil extrem viele Menschen mit Fußball erreicht werden. Zudem wird Fußball professionell und geschickt vermarktet. Auf der anderen Seite ist es natürlich traurig, dass andere Sportarten nicht genauso honoriert werden. Klar wünschte ich mir mehr Geld für die Leichtathletik, für die Kanufahrer und Ruderer. Es muss ja nicht unbedingt mit den Summen vom Fußball passieren. Aber wenn ich sehe, wie Sportler in Randsportarten teilweise von 150 Euro im Monat leben müssen, dann haben die das in meinen Augen nicht verdient. Sie trainieren täglich fünf bis sechs Stunden, das ist im Fußball selten der Fall. Was Prävention und Körperpflege angeht, sind Fußballer auch nicht unbedingt so dynamisch wie andere Sportler, keine Frage, aber da muss der Verein was machen. Der hat ja die Möglichkeit, das Training entsprechend zu gestalten. Fußballvereine scheuen davor oft zurück und wollen die Spieler nicht stressen, damit man sie nicht verliert. Dieses Denken sollte man aber aufbrechen und verbessern.
Ist der RB für Sie als Arbeitgeber noch interessant?
Tim Lobinger:
Da passiert relativ viel zur Zeit, keine Frage. Ich würde aber nicht nochmal nach Leipzig gehen, einfach weil mein Lebensmittelpunkt in Süddeutschland ist. Natürlich habe ich noch ein hervorragendes Verhältnis zu den Verantwortlichen und verfolge alles mit Interesse. Da ist auch keine Tür zu.
Und wie sieht es mit der Leichtathletik-EM aus? Werden Sie die verfolgen?
Tim Lobinger:
Die WM 2017 hab ich im Fernsehen ganz intensiv verfolgt, da ich mich ja kaum bewegen konnte. Zur EM im August möchte ich mindestens drei bis vier Tage in Berlin sein. Ich bin gerade im Verhandlungsprozess, ob ich nicht etwas im Bereich Berichterstattung mache und damit dann die ganze Zeit vor Ort bin. Das ist aber noch nicht spruchreif. Auf alle Fälle will ich Alina und Freunden ermöglichen, jeden Tag im Stadion zu sein, damit sie sich erholen und ich meine Dankbarkeit ihnen gegenüber zeigen kann.
Wie schätzen Sie den Nachwuchs im Stabhochsprung ein?
Tim Lobinger:
Ich habe ein gutes Verhältnis zu Tobias Scherbarth, der erst letzte Woche bei mir war und mit dem ich mich lange unterhalten habe. Was den Stabhochspringern ein bisschen verloren gegangen ist, ist vielleicht das, was wir damals in der Gruppe hatten: diesen totalen Willen, das Leben nur über Stabhochsprung zu definieren. Da hat keiner gesagt, er sei nach einer Meisterschaft erstmal im Urlaub, obwohl es noch Wettkämpfe gab. Inzwischen gibt es in meinen Augen leider wenig Leichtathleten, die bereit sind, volle Leidenschaft an den Tag zu legen. Das fehlt mir gerade in der nationalen Szene. International sind die Stabhochspringer da schon eher auf dem Vormarsch. Und auch die Speerwerfer haben da gute Karten.
Was wäre Ihr Rat an Ihre Nachfolger?
Tim Lobinger:
Wenn mir etwas Spaß macht, ist mir am Ende des Tages egal, was ich verdiene, wenn ich nur ein Dach über dem Kopf habe und etwas zu essen. Mittlerweile sehe ich sehr, sehr wenige mit dieser Überzeugung, aber die sollte es geben. Ich wünsche mir mehr Mut, alles zu geben, auch wenn noch nicht fest steht, was man dafür zurückbekommt.
Sie beweisen es selbst jeden Tag von Neuem. Wie geht es denn mit Ihrer Behandlung weiter?
Tim Lobinger:
Das lässt sich nach der Neudiagnose vom Januar schwer sagen. Was viele vielleicht nicht wissen: Blut wird im Knochen hergestellt und ich habe mutierte Zellen im Knochenbereich, die einen neuen Krebsbefall auslösten. Durch die Medikamente, die ich nehme, schwemmen die kranken Zellen aber nicht als Masse in mein Blut. Dadurch konnte man den Befall ein einbremsen und deshalb muss ich auch keine Chemotherapie machen. Ich bekomme dafür Lymphzellen-Infusionen von meinem Spender. Was in sechs Monaten gemacht werden muss, ist schwer zu sagen. Da muss ich wieder eine Knochenpunktion machen und dann weiß man mehr. Aber daran möchte ich jetzt noch nicht denken.